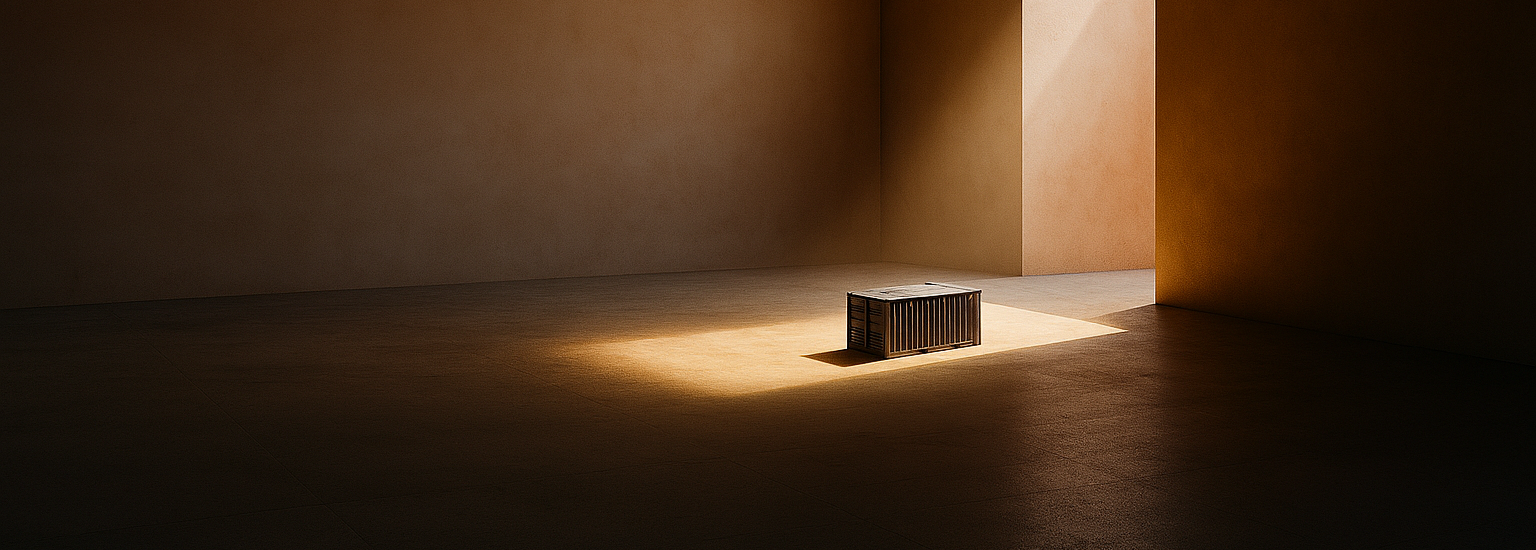In der Tech-Welt fällt mir immer wieder ein Muster auf: Entscheidungen werden häufig über Ablehnung begründet.
„Ich nutze kein X, weil Y doof ist.“
Aber was wäre, wenn wir uns für Tools, Frameworks und Workflows entscheiden würden, weil sie mit uns in Resonanz stehen?
Resonanz bedeutet für mich: Ein Werkzeug passt zu mir – technisch, konzeptionell, manchmal auch intuitiv.
Es unterstützt meine Arbeitsweise, ohne sich aufzudrängen. Es fühlt sich richtig an – nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es in meinem Kontext Sinn ergibt.
Technische Wahl – aus Resonanz, nicht aus Protest
Ich arbeite mit Podman – nicht, weil ich Docker ablehne, sondern weil Podman sich für mein Setup stimmig anfühlt.
Es fügt sich gut in meine Arbeitsweise ein: WSL, RAM-Disk, VS Code DevContainer.
Ich schätze die Rootless-Architektur, die Integration mit systemd und die Klarheit im Design.
Podman gibt mir das Gefühl, mein Setup wirklich zu verstehen und steuern zu können – ohne dass ich gegen etwas kämpfen muss.
Docker ist nicht „falsch“. Es ist einfach nicht das, was sich mit meinen Erwartungen deckt.
Was sagt meine Toolwahl über mich?
Technische Entscheidungen sind nie nur funktional – sie sagen auch etwas über die Person dahinter.
Ich mag Klarheit, Modularität, Kontrolle. Ich arbeite gern mit Dingen, die sich gut dokumentieren lassen und nachvollziehbar sind.
Ich entscheide nicht aus Trotz – sondern aus technischer und emotionaler Resonanz.
Und vielleicht ist das der eigentliche Kern: Ich wähle, was mir entspricht. Nicht, weil ich genügend Kritikpunkte an anderen Optionen gefunden habe.
Resonanzbasiertes Denken – auch außerhalb der Technik
Auch jenseits von Tools und Frameworks begegnet mir dieses Muster:
Entscheidungen werden oft über Ablehnung begründet – statt über das, was gut tut.
- Ich lese ein Buch nicht, weil der Autor unsympathisch ist – statt: Ich lese, was mich inspiriert
- Ich meide bestimmte Plattformen – statt: Ich nutze die, die mir Klarheit oder Nutzen bringen
- Ich definiere mich über Abgrenzung – statt über Gemeinsamkeiten
Mir fällt auf, wie viel Energie darauf verwendet wird, herauszufinden, was nicht passt, was stört, was nervt und was man ablehnen kann.
Aber viel seltener wird gefragt:
Was bringt mich weiter?
Was tut mir gut?
Was unterstützt mich in dem, was mir wirklich wichtig ist?
Resonanzbasiertes Denken heißt für mich:
Nicht das Störende in den Vordergrund stellen – sondern das Stimmige.
Nicht gegen etwas sein – sondern für etwas.
Resonanz im Team – und was, wenn sie fehlt?
Resonanzbasiertes Denken funktioniert nicht nur im stillen Kämmerlein.
In Teams begegnen wir Entscheidungen, die sich für uns persönlich nicht stimmig anfühlen – aber für das Team als Ganzes sinnvoll sind.
Das ist keine Schwäche des Konzepts, sondern seine Bewährungsprobe.
Was tun, wenn meine Resonanz fehlt – aber die kollektive Richtung stimmt?
Vielleicht hilft da ein Perspektivwechsel:
- Resonanz muss nicht immer individuell sein – sie kann auch geteilt werden.
- Manchmal resoniert nicht die Entscheidung selbst, sondern der Prozess, wie sie getroffen wurde.
- Und manchmal ist es stimmig, zurückzutreten, weil das größere Ganze auch zählt.
Resonanzbasiertes Denken heißt nicht: Ich bekomme immer, was sich für mich gut anfühlt.
Es heißt: Ich bleibe im Kontakt mit mir – auch wenn ich mich für das Team bewege.
Vielleicht ist das die eigentliche Kunst:
Nicht gegen sich entscheiden – sondern für etwas, das noch mehr Bedeutung hat.
Und was ist mit Moral?
„Resonanzbasiertes Denken“ ersetzt keine ethische Reflexion.
Es fragt: „Was fühlt sich stimmig an?“ – nicht: „Was ist richtig?“
Aber manchmal liegt beides nah beieinander.
Und manchmal eben nicht.
Ich glaube, dass individuelle Entscheidungen nicht den Markt verändern –
aber sie verändern mich.
Und vielleicht ist das der Anfang.
Schlusswort
Vielleicht sollten wir (nicht nur) in der Tech-Welt öfter innehalten und fragen:
„Warum passt X zu mir?“
statt:
„Was kann ich gegen Y sagen?“
Denn am Ende geht es nicht darum, gegen etwas zu sein – sondern für etwas.
Und vielleicht ist das die eigentliche Entscheidungskompetenz:
Nicht das Störende zu identifizieren – sondern das Stimmige zu erkennen.
Wer so entscheidet, wählt nicht nur ein Tool.
Sondern eine Haltung.
Ich habe hier die technische Seite dieses Gedankens beleuchtet – aber vielleicht lässt er sich auch in anderen Bereichen gewinnbringend weiterdenken.“.
Was bringt dich weiter?
Was tut dir gut?
Was unterstützt dich in dem, was du wirklich tun willst?
Herleitung "resonanzbasiertes Denken"
Der Begriff resonanzbasiertes Denken ist eine kontextuelle Neuschöpfung, die sich aus mehreren Denktraditionen speist:
- Resonanz als Konzept wurde u. a. von Hartmut Rosa geprägt, der sie als lebendige, antwortende Beziehung zur Welt beschreibt – jenseits von Kontrolle oder Konsum (vgl. Rosa 2016).
- Denken in Passung findet sich in systemischen, gestalterischen und psychologischen Ansätzen, etwa in der Frage: Was passt zu mir, meinem Kontext, meinem Ziel?
- Abgrenzung vom defizitorientierten Denken: In vielen technischen und gesellschaftlichen Diskursen wird über das „Nicht-Funktionierende“ entschieden – „Ich nutze X, weil Y schlecht ist.“ Resonanzbasiertes Denken schlägt vor, stattdessen über das Stimmige zu entscheiden – „Ich nutze X, weil es mit mir resoniert.“
Dabei ersetzt resonanzbasiertes Denken keine moralische Reflexion – es verschiebt nur den Fokus:
Von der Frage „Was ist richtig?“ hin zur Frage „Was fühlt sich stimmig an?“
Diese beiden Perspektiven können sich ergänzen – oder auch in Spannung zueinander stehen.
Resonanz ist kein moralischer Freifahrtschein.
Aber sie kann ein Kompass sein – gerade dann, wenn moralische Klarheit fehlt oder überfordert.
Die Wortbildung „resonanzbasiert“ ist dabei bewusst gewählt:
- Sie verbindet das intuitive Moment von Resonanz mit einem strukturierten Denkansatz
- Sie erlaubt eine positive Begründung von Entscheidungen, ohne andere Optionen abwerten zu müssen
- Sie öffnet den Raum für Selbstreflexion, Kontextsensitivität und Offenheit
Quellen
1. Hartmut Rosa – Resonanz als Weltbeziehung
- Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp Verlag, Berlin.
- Zentrale Quelle für das Resonanzkonzept: Weltbeziehung als antwortende, berührbare Verbindung – jenseits von Kontrolle oder Konsum.
2. Donald Norman – Emotionales Design
- Norman, Donald A. (2004): Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books.
- Zeigt, wie technische Objekte emotional resonieren und wie das unsere Entscheidungen beeinflusst.
3. Niklas Luhmann – Systemtheorie
- Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp Verlag.
- Kommunikation als selektive Resonanz innerhalb von sozialen Systemen – hilfreich zur Einordnung individueller Passung.
4. Byung-Chul Han – Kritik an Kontrolllogik
- Han, Byung-Chul (2012): Transparenzgesellschaft. Matthes & Seitz Berlin.
- Kritisiert die Reduktion von Weltbeziehung auf Sichtbarkeit und Kontrolle – Resonanz als Tiefe und Berührbarkeit.
5. Peter Kruse – Intuition und Komplexität
- Kruse, Peter (diverse Vorträge und Interviews, z. B. auf YouTube oder in Fachmagazinen)
- Spricht über intuitive Entscheidung in komplexen Systemen – oft über Resonanz, ohne den Begriff explizit zu verwenden.